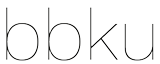KöSt-Zuschlag wegen unterlassener Empfängerbenennung
Wenn ein Steuerpflichtiger dem Finanzamt die Empfänger seiner Zahlungen nicht bekannt geben kann, hat die Behörde diese Betriebsausgaben zu streichen.
Die Abgabenbehörde kann vom Steuerpflichtigen verlangen, dass er die Empfänger von Zahlungen, die der Steuerpflichtige steuerlich als Betriebsausgaben ansetzen möchte, bekannt gibt (sogenannte Empfängerbenennung). Zweck dieser Regelung ist, dass die Behörde beim Zahlungsempfänger prüfen kann, ob dieser die erhaltenen Zahlungen entsprechend versteuert. Kann oder will der Steuerpflichtige der Aufforderung zur Empfängerbenennung nicht nachkommen, sind einerseits die Zahlungen nicht als Betriebsausgaben absetzbar und erfolgt andererseits bei Kapitalgesellschaften der Ansatz eines 25%-igen KöSt-Zuschlags.
Dokumente in der Baubranche
Im Rahmen einer Außenprüfung bei einer in der Baubranche tätigen GmbH wurden Betriebsausgaben wegen fehlender Empfängerbenennung nicht anerkannt und zusätzlich der 25%-ige Zuschlag zur Körperschaftsteuer verhängt. Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens bestätigte das Bundesfinanzgericht (BFG) diese Maßnahmen mit der Begründung, dass die GmbH den bei kommerziellen Bauvorhaben üblichen Gepflogenheiten und Sorgfaltsmaßstäben, die bei der Prüfung der beauftragten Unternehmen anzuwenden sind, in keinster Weise entsprochen habe.
Die GmbH habe zwar einzelne Dokumente, welche bei kommerziellen Bauvorhaben beim Auftraggeber üblicherweise vorhanden gewesen seien, vorlegen können (Auszüge aus Firmenbuch, Gewerberegister, Rechnungen und Überweisungsbelege), nicht aber jene Unterlagen, welche tatsächlich die Erbringung von Leistungen durch die Auftragnehmer dokumentiert hätten, nämlich schriftliche Werkverträge, Lichtbildausweise der Zeichnungsberechtigten, die aus Bautagebüchern, üblichem Schriftverkehr oder Besprechungsprotokollen bestehende Baustellendokumentation sowie Pläne oder Unterlagen, die eine Überprüfung der technischen Leistungsfähigkeit der zu beauftragenden Unternehmer indiziert hätte. Die GmbH habe daher nicht den üblichen Sorgfaltsmaßstab walten lassen, weshalb ihr ein Verschulden an der nicht erfolgten Empfängerbenennung anzulasten sei.
Nicht geringfügige Sorgfaltspflichtverletzung
Die GmbH brachte dagegen vor, dass die Nichtnennung der Empfänger nicht ihren „geringfügigen“ Sorgfaltspflichtverletzungen geschuldet waren, sondern dem Umstand, dass die Bankinstitute nicht ihre Aufgaben wahrgenommen haben. Weiters dürfe der KöSt-Zuschlag nur dann verhängt werden, wenn der Zahlungsempfänger vom Abgabepflichtigen absichtlich verschwiegen werde.
Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) wies die Revision gegen das BFG-Erkenntnis ab und hielt fest, dass die GmbH dadurch, dass sie u.a. keine Verträge mit den Auftragnehmern abgeschlossen, keinerlei Unterlagen zu dem Bauvorhaben oder Pläne vorgelegt, die Ausweise nicht kopiert oder den Firmensitz der Auftragnehmer nicht aufgesucht habe, eine nicht geringfügige Sorgfaltspflichtverletzung begangen habe. Es geht laut VwGH zu Lasten des Abgabepflichtigen, wenn dieser Geschäftsbeziehungen eingeht, in denen ihm die Nennung der Zahlungsempfänger nicht möglich ist. Zusätzlich besteht für das Verhängen des KöSt-Zuschlags keine Notwendigkeit, dass die Zahlungsempfänger vom Abgabenpflichtigen absichtlich verschwiegen werden.
Fazit
Die sorgfältige Prüfung der Auftragnehmer und eine entsprechende Dokumentation dieser Prüfung schützt vor solchen Nachteilen.
KöSt-Zuschlag wegen unterlassener Empfängerbenennung Read More »