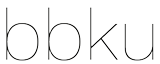Corona-Virus: Erleichterungen bei der steuerlichen Außenprüfung
Nach Auskunft des Finanzministeriums (Stand 16.03.2020) werden Außenprüfungshandlungen, Nachschauen und Erhebungen der Finanzämter, der Finanzpolizei, der Zollämter und des Prüfdienstes für lohnabhängige Abgaben und Beiträge bei Abgabepflichtigen bis auf weiteres nicht begonnen, wenn die betroffenen Unternehmen glaubhaft machen, dass sie diese Prüftätigkeiten aufgrund der Coronavirus-Krise nicht ausreichend unterstützen können. Amtshandlungen, die bereits begonnen wurden, werden aus denselben Gründen ausgesetzt oder unterbrochen.
Für die Glaubhaftmachung eines Ersuchens auf Nichtdurchführung bzw. Aussetzung oder Unterbrechung der oben angeführten Ermittlungshandlungen ist lt. Finanzministerium folgende Formulierung ausreichend:
“Ich bin in meiner betrieblichen Tätigkeit (Angabe der Branche…) von den Auswirkungen der SARS-CoV-2-Virus-Infektion betroffen. Das bewirkt, dass ich derzeit nicht in der Lage bin, die entsprechenden Ressourcen für die Wahrnehmung der gesetzlichen Mitwirkungspflichten bereit zu stellen. Sollte diese Notsituation wegfallen, werde ich das der Abgabenbehörde mitteilen bzw. mit dem Prüfungs- , Kontrollorgan unverzüglich Kontakt aufnehmen.”
Von diesen Maßnahmen ausgenommen sind Amtshandlungen, die von den Finanzstrafbehörden, den Staatsanwaltschaften und den Gerichten beauftragt wurden sowie solche, die aufgrund von Anzeigen einen Verdacht rechtswidriger Verhaltensweisen von Abgabenpflichten begründen.
Dies gilt auch für angezeigte rechtswidrige Verhaltensweisen (bspw. illegale Beschäftigung, illegales Glücksspiel) deren Kontrolle, Ermittlung und Verfolgung den Organen der Abgabenbehörden (Finanzpolizei) übertragen wurde.
Sollten Sie in Ihrer betrieblichen Tätigkeit von den Auswirkungen der SARS-CoV-2-Virus-Infektion betroffen sein, setzen wir uns für Sie gerne mit der Finanzverwaltung in Verbindung, um eine Unterbrechung der Amtshandlung zu erwirken!
Corona-Virus: Erleichterungen bei der steuerlichen Außenprüfung Read More »